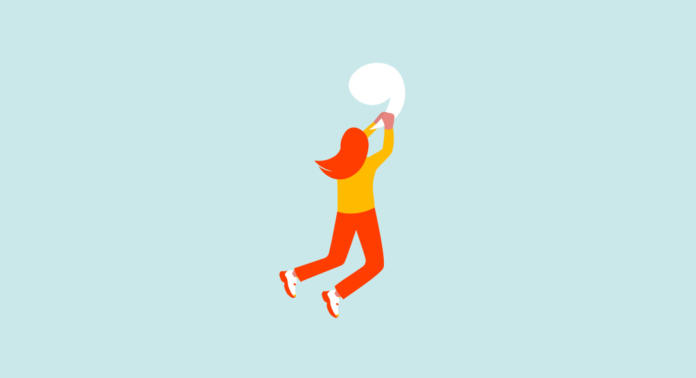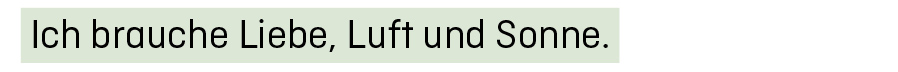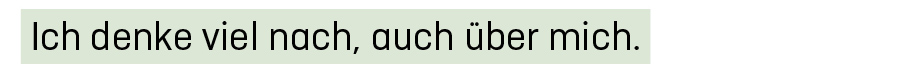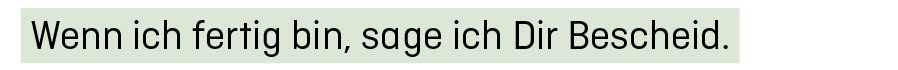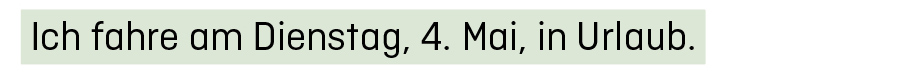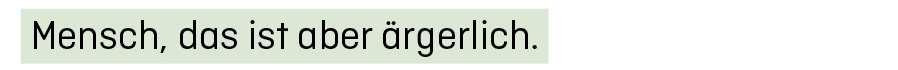Kommaregeln auf die Schnelle
In der deutschen Sprache setzt man das Komma in erster Linie nach grammatikalischen Regeln; seit der neuen Rechtschreibung gibt es aber viele Fälle, in denen das Setzen optional ist. Vorgesehen ist das Komma
- bei Aufzählungen
- bei dem Satz nachgestellten Zusätzen
- zum Abgrenzen von Nebensätzen
- beim Gliedern zum Beispiel von Datumsangaben und von Partizip- und Infinitivgruppen
- bei Nachschüben
Das Dezimalkomma, also das Komma als Dezimaltrennzeichen, kommt zum Beispiel bei Preisen vor.
Das Komma im Einsatz
Grundsätzlich setzt man das Komma ohne Zwischenraum direkt nach dem letzten Buchstaben. Auch in der französischen Sprache, in der man viele Satzzeichen mit einem Zwischenraum nach dem letzten Zeichen platziert, steht es direkt am Buchstaben.
Ersetzt wird das Komma je nach Inhalt hin und wieder vom Gedankenstrich. Man bevorzugt den Gedankenstrich dann, wenn in der gesprochenen Sprache eine Pause verdeutlicht werden soll und das Komma nicht stark genug wirkt.
Form und Stand des Kommas
Die Form des Kommas ist identisch mit der des Apostroph. Es erinnert also je nach Schriftart an eine 9 wie zum Beispiel bei der Didot. In vielen Schriften neigt es sich von rechts oben nach links unten, wie zum Beispiel bei der Titillium. Alternativ steht es – wie zum Beispiel bei der Arial – auch senkrecht, und nur das Ende erhält eine leichte Rundung.
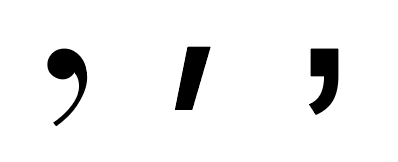
Verschiedene Kommata-Formen in verschiedenen Schriften:
die Didot, die Titillium und die Arial.
Die vertikale Ausrichtung erfolgt an der Grundlinie. Bei einer Tropfenform liegt der obere runde Teil des Tropfens direkt auf der Grundlinie, und von dort führt der Bogen von dort nach unten weg. Nicht tropfenförmige Varianten wachsen von der Grundlinie aus in etwa gleich nach oben und unten.
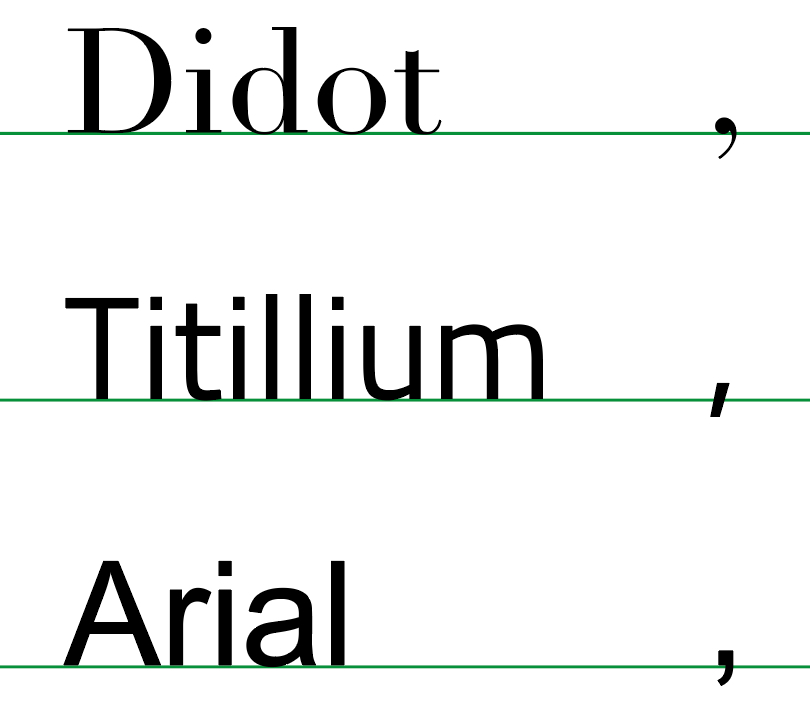
Schreibregeln in der Mikrotypografie
Teil 1: Mikrotypografie: Grundlagen der Schreibregeln
Teil 2: Gedankenstrich
Teil 3: Anführungszeichen
Teil 4: Apostroph
Teil 5: Semikolon
Teil 6: Klammer
Teil 7: at-Zeichen
Teil 8: Scharfe S
Teil 9: Fragezeichen
Teil 10: Ausrufezeichen
Teil 11: Paragrafenzeichen
Teil 12: Copyright-Zeichen
Teil 13: Gradzeichen
Teil 14: Komma (dieser Artikel)
Bildquelle: Arina Kumysheva via Shutterstock.com